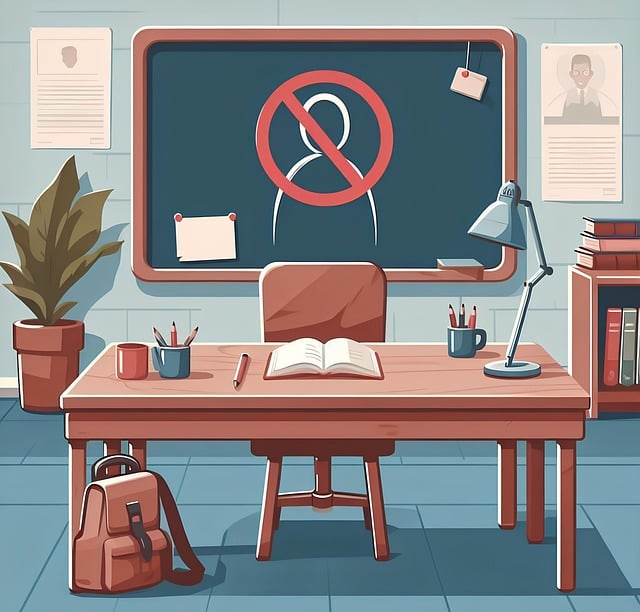
Das deutsche Schulsystem ist plural und selektiv. Plural bedeutet, dass es unterschiedliche Schulformen gibt, selektiv bedeutet, das bereits sehr früh (in der Regel in der vierten Klasse (in Bremen und Berlin in der 6. Klasse) über die weiterführende Schule entschieden wird. Im Prinzip kann auch danach noch die Schulform gewechselt werden. Die Gesamtschule wurde gegründet, damit solche Wechsel leicht und problemlos jederzeit möglich sind und ein kompletter Schulwechsel nicht notwendig ist. Die Gesamtschule ist nach wie vor nicht die Regel. Stattdessen gibt es nach der obligatorischen Grundschule von vier (oder sechs Jahren) die Möglichkeiten oder Zwänge unterschiedliche Schulformen zu besuchen. Durch die 16 Bundesländer besteht eine große Pluralität. Hier gebe ich das Beispiel für Nordrhein-Westfalen. In NRW kann nach der Grundschule die Gemeinschaftsschule, die Gesamtschule, die Realschule, das Gymnasium oder eine Förderschule besucht werden. Die Förderschule steht bereits ab der 1. Klasse als Möglichkeit zur Verfügung, obwohl gleichzeitig für alle Schulen der Auftrag zur Inklusion besteht. Bei Beginn einer Berufsausbildung wird weiterhin die Berufsschule besucht. Schulabschlüsse können, wenn sie aus unterschiedlichen Gründen nicht gemacht wurden am Berufskolleg, an Berufsoberschulen, Abendgymnasien oder Fernstudien gemacht oder nachgeholt werden.
Die Schulpflicht gilt in der Regel für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr und dauert bis zum 18. Lebensjahr oder bis zum Abschluss einer bestimmten Schulform.
Derzeit besuchen ca. 11 Millionen Schüler*innen die Schulen in Deutschland. 2024 wurden 827 500 Kinder zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeschult. Die Bundesrepublik hat fast 85 Millionen Einwohner*innen. Im Vergleich wurden 2024 in Irland 556 084 Schüler*innen eingeschult. Irland hat eine Bevölkerung von etwas mehr als 5 Millionen. Die Schulpflicht sorgt dafür, dass die meisten Kinder eine Schule besuchen. Dennoch gibt es Kinder, die nicht zur Schule gehen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Schule gehen, liegt in Deutschland im steigenden Bereich mit derzeit fast 7 Prozent, allerdings ist die Erfassung schwierig, da in die Statistik Fehlzeiten von Schüler*innen, die offiziell noch die Schule besuchen, nicht eingehen.
Kritik an den Schulformen und am schulischen Lernen
Die verschiedenen Schulformen in Deutschland stehen konstant in der Kritik. Einige der Kritikpunkte sind:
Die frühe Selektion: die Aufteilung in verschiedene Schulformen bereits nach der Grundschule führt dazu, dass Kinder sehr früh in eine Richtung gebracht werden, obwohl ihre Potenziale sich noch in Entwicklung befinden. Es gibt zudem Bedenken hinsichtlich der Chancengleichheit, da Kinder aus sozial benachteiligten Familien oft schlechtere Bildungswege einschlagen und weniger Unterstützung erhalten. Aus der Perspektive moderner Pädagogik kritisieren Wissenschaftlcer*innen die starre Struktur der Lehrpläne und die oft veralteten Unterrichtsmethoden, die nicht auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen eingehen. Der hohe Leistungsdruck, insbesondere am Gymnasium, wird als problematisch angesehen und kann zu Stress und psychischen Problemen bei den Schüler*innen führen. Die Integration und Inklusion von Schüler*innen mit Migrationshintergrund und besonderen Bedürfnissen wird häufig als unzureichend angesehen. Ebenso werden die Beziehungsqualität und die veralteten Lehrmethoden kritisiert. (Nationaler Bildungsbericht 2024)
Schulabsentismus
Bist du schon einmal von etwas ferngeblieben, einfach nicht hingegangen, abwesend geblieben? Von der Schule, der Hochschule, der Versammlung, dem Arbeitsplatz, der Familienfeier, dem Fest, dem Jahrgangstreffen o.ä.? Wahrscheinlich hattest du gute Gründe dafür: Angst? Unsicherheit? Keine Energie dafür? Einfach etwas viel Interessanteres tun? Wahrscheinlich wurde dein Abwesend-Sein bemerkt. Lücken ziehen Blicke auf sich, leere Stühle werfen Fragen auf. Abwesende sind meist anwesend, über sie wird gesprochen. Sorgen werden geäußert, Ärger, Frustration, Sich-Wundern. Aber jetzt sind sie nicht da, und ein Dialog kann nicht stattfinden. Später bedauern sie, dass sie nicht dabei waren, oder auch nicht.
Das zeitweise oder konstante, nachhaltige Fernbleiben von der Schule ist ein weltweites Geschehen, die Kontexte und der Umgang damit sind sehr unterschiedlich und komplex: sie reichen von nicht vorhandenen Möglichkeiten die Schule überhaupt zu erreichen, Kinderarmut und Kinderarbeit, Strafsystemen in der Schule bis zu den Ängsten von Kindern vor gut ausgestatteten Schulumgebungen.
Eltern und Schule werden verantwortlich gemacht, es finden gegenseitige Schuldzuweisungen statt. Elternblaming: Warum erlauben die das den Kindern? Sie sollten ihren Erziehungsstil verändern, auf Eltern wird Druck ausgeübt. Oder Lehrer*innenblaming: warum geben die nicht genug Unterstützung? Warum ist die Schule so chaotisch? Warum funktionieren Schulexeprimente nicht? Oder: die Schüler*innen werden pathologisiert, charakterisiert, immer wieder diagnostiziert (etwas mit ihnen stimmt nicht).
Die Gemeinsamkeit aller Beteiligten liegt hingegen in ihren Ohnmachtsgefühlen sowie in dem Gefühl der Dringlichkeit in der Zeitperspektive (von ca. 12 Jahren Schulzeit).
Schauen wir zunächst auf einige gängige Ergebnisse aus Studien unterschiedlicher Länder:
Das Fernbleiben von der Schule ist ein gradueller Prozess, konstantes und nachhaltiges Fernbleiben entsteht nicht von heute auf morgen. Die genauen Prozesse sind noch wenig untersucht.
Bezogen auf die Schüler*innen werden hohe Angstgefühle festgestellt; hoher Stress führt zu irrationalen Interpretationen der Schule (die Schule wird gewissermaßen sukzessive zu einem Moloch in der Wahrnehmung der Kinder). Vernachlässigungen, Suchtproblematiken, psychische Herausforderungen und Belastungen der Eltern sind Faktoren. Der sozioökonomische Status scheint keine wesentliche Rolle zu spielen. Die Untersuchung der Schulstrukturen zeigt zu wenig professionelle emotionale Unterstützung, geduldete Bullying-Strukturen, Schulabläufe, didaktische Methoden, die die Schüler*innen nicht angemessen adressieren (Knage 2022; Lomholt et al. 2022; Geng et al. 2020; Pijl et al. 2021; Mooney et al. 2021; Woodland et al. 2023); Knage, Søndergard 2023).
In den letzten Jahren seit Corona ist krankheitsbedingtes häufiges Fehlen als bedeutsamer Faktor in den Fokus gerückt: durch die Umwelt verursachte Krankheiten (Allergien) oder andere Krankheiten machen einen erheblichen Anteil dauerhaften Fernbleibens aus sowie Autismus in der Kombination mit belastenden Gesundheitsfaktoren.(Geng et al. 2020; Mattson et al. 2022). Wenn die Stimmen der Schüler*innen mit Migrationshintergrund nicht gehört werden, besteht ein größeres Risiko, dass sie fernbleiben. Das in den letzten Jahren generierte wissenschaftliche Wissen und daraus gezogene Schlussfolgerungen haben noch nicht zu bedeutsamen Veränderungen geführt. Was also fehlt?
Dänische Studien bieten neue Ansatzpunkte. Sie schauen dort hin, wo Kinder trotz aller Interventionen nicht zur Schule gehen möchten. Die Autor*innen fragen. Was ist der Prozess? Was sagen uns die Kinder? Welches Wissen stellen Sie uns zur Verfügung? Was fangen wir dann mit diesem Wissen an? Wie erhalten wir es überhaupt? Und in welcher Relation steht es zum Wissen der Eltern und Lehrer*innen? Die Autor*innen möchten die Fluchtlinien nachvollziehen (Knage 2022; Lomholt et al. 2022). Sie begreifen Abwesenheit als eine Form der Destabilisierung des Systems: nicht immer ist die Stabilisierung des Systems durch Anpassung der Schüler*innen die Antwort, sondern es bedarf möglicherweise einer Neuausrichtung des Systems, damit Stabilität in der Gesellschaft wieder möglich wird. In Interviews mit Lehrerinnen, Schülerinnen, Eltern sind folgende Schwerpunkte in den Vordergrund getreten: Professionellenebene: die Bürokratie; die Schulpflicht zwingt die Schulen zu Meldungen (Bußgelder, zwangsweise Abholung der Schülerinnen sind möglich), und genauer Dokumentation (was in der Praxis häufig nicht möglich ist), Fallbesprechungen, Maßnahmen zur Herstellung der Ordnung. Professionelle empfehlen multiprofessionelle Teams unter Einbeziehung von Schulpsycholog*innen als Teil der Schulteams. Hausbesuche mit Gesprächen halten sie für einen wichtigen Teil der Adressierung von Schulabsentismus. Den Eltern hingegen macht die Bürokratie, die partielle Kriminalisierung durch Strafen Sorgen sowie die Ängste um die Zukunft der Kinder. Die Schüler*innen hingegen äußern ganz andere Aspekte: sie sind sich bewusst, dass sie etwas verpassen, zum Teil bedauern sie, dass sich Möglichkeiten geschlossen haben, ein anderer Teil der Schüler*innen schätzt die Erfahrungen, die sie anstelle der Schule gemacht haben, als bedeutsamer ein. Traumatische Erfahrungen, Bullying in der Schule, Dyslexia, Autismus, Ängste, massive Erschöpfungsgefühle, die Bedeutung anderer Interessen und Hobbies (künstlerische Arbeit, Gartenarbeit, Tiere, politische Aktivitäten u.a.). Das alles sind für die Schüler*innen Gründe, die so schwer wiegen, dass sie die Schule nicht besuchen möchten. Die Wahrnehmung ihrer spezifischen Interessen außerhalb der Schule ermöglicht ihnen, eine Stimme zu haben, eigenständig zu agieren und zu denken. Im Grunde verweigern die Kinder den Zugriff der Institutionen auf ihren Körper, und ihre Psyche. Damit werden Sie zu Botschafter*innen der Lücken des Schulsystems: der Mangel an Sorge in der Institution, die Unmöglichkeit der Institution Zugehörigkeitsgefühle herzustellen. Wenn das Verhalten der Kinder als Einladung gesehen würde, die Sorge als essenziell für das Zusammenleben in der Gemeinschaft und Gesellschaft zu betrachten könnte eine Denken in Gang gesetzt werden, das jenseits instrumenteller Lösungen das Bild vom Kind, das Zuhören, die Sorge und den Dialog mit den Kindern als Rechtssubjekte in den Fokus rückt. Die jungen Menschen betonen, wie wichtig ihnen Bezugspersonen sind, vertrauensvolle Bindungen. Vereinsamung und vollständiger sozialer Rückzug hingegen schaffen Leidenssituationen.
Die Europäische Union hat auf politischer Ebene die Implementierung des Lundy-Modells zur Sicherstellung und Implementierung der Kinderrechte und der Sicherstellung einer Partizipation empfohlen, die mehr ist als die Stimmen der Kinder zu hören. Eine Partizipation, in der Erwachsene in ihren Systemen sich verändern müssen und in einem Prozess eintreten, der ein Lernen von Kindern möglich macht, erst dann ist die Wechselseitigkeit von Lernprozessen gewährleistet, Veränderung möglich.
Das Modell wurde von der irischen Professorin für internationale Kinderrechte Laura Lundy entwickelt und als erster Staat wurde es von der irischen Regierung implementiert. Das Modell fordert die Institutionen zur Veränderung auf und eine Haltung der Sorge und des Dialogs zu entwickeln:
Räume (space)
Sind junge Menschen nach ihrer Meinung gefragt worden?
Wie viele Möglichkeiten gab es?
Ist die Institution zugänglich, freundlich und sicher?
Ist das Personal angemessen geschult und auf dem neuesten Stand der pädagogischen Erkenntnisse? Bemüht sich die Institution aktiv um die Integration von Kindern mit unterschiedlichen Hintergründen? Werden ihre Bedürfnisse angemessen adressiert?
Stimmen (voice)
Haben junge Menschen die Informationen erhalten, die sie benötigen, um sich eine Meinung zu bilden?
Wissen junge Menschen über die Bedingungen ihrer Teilhabe Bescheid?
Werden kreative und unterhaltsame Aktivitäten genutzt, um junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre Meinung zu Themen zu äußern?
Gibt es genug eingeplante Zeit, um sich mit den Themen zu befassen?
Sind die Ressourcen und Methoden für junge Menschen zugänglich, jugendsicher und jugendfreundlich?
Publikum, Zuhörer*innenschaft (audience)
Sind geeignete Entscheidungsträger beteiligt und engagiert?
Gibt es einen klaren und vereinbarten Prozess, um die Stimmen und Ansichten junger Menschen zurück zu kommunizieren?
Wissen junge Menschen, mit wem ihre Ansichten geteilt werden und was danach mit ihnen passiert?
Wissen Entscheidungsträger, wie die Ansichten junger Menschen in ihre Entscheidungsprozesse einfließen werden?
Ist die Person, die die Ansichten junger Menschen ’empfängt’, die Person mit der Macht, Entscheidungen zu treffen (oder zu beeinflussen)? Einfluss (influence)
Wurden die Ansichten junger Menschen im Entscheidungsprozess berücksichtigt, und wie wird dies dokumentiert?
Wurden junge Menschen darüber informiert, wie ihre Ansichten eine Entscheidung beeinflusst haben – und wenn nicht, warum?
Gibt es Verfahren, damit junge Menschen Entscheidungsträger für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft ziehen können?
Wann und wie werden junge Menschen wissen oder sehen, welche Auswirkungen ihre Handlungen hatten?
Der bedeutende Aspekt am Lundymodell ist für mich die Betonung des Dialoges zwischen Erwachsenen und jungen Menschen und die Betonung der Notwendigkeit, dass diese dialogische Haltung und ihre Umsetzung von den Erwachsenen gelernt werden muss. Hier liegt die Schwierigkeit, da viele Erwachsene diese Erfahrung selbst als Kinder und Jugendliche nicht machen konnten. Lundy plädiert für eine Vermittlung dieser Fähigkeiten, in Projekten, in Fortbildungen. Wenn wir bei jedem einzelnen Kind genau zuhören, daraus Handeln entwickeln, dann verändern sich damit einhergehend auch die Strukturen.
