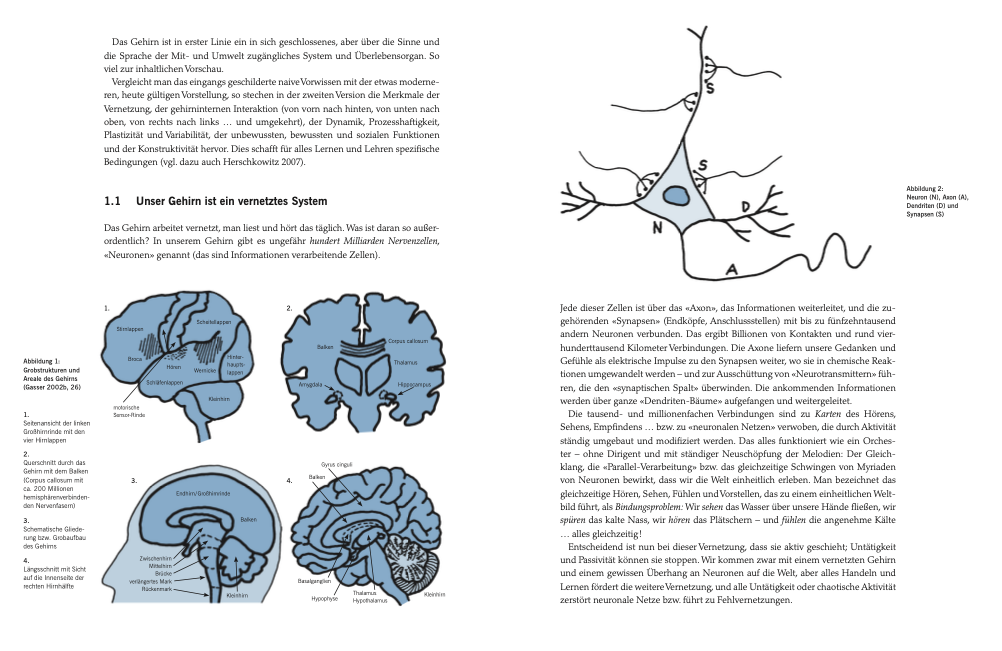Der folgende Beitrag ist teilweise die verschriftlichte, gekürzte Fassung eines Vortrags, der an einem Forschungstag der Hochschule Rhein-Waal gehalten werden sollte. Der Forschungstag mit dem Thema „Frauen in der Wissenschaft – Women in Science“ musste wegen eines Bombenfunds abgesagt werden. Jeden Tag werden in der Bundesrepublik Deutschland Bomben aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefunden. Kleve ist ein besonders betroffene Stadt. Ein Krieg hat nicht nur aktuelle Auswirkungen, sondern die Folgen sind sowohl was die Umwelt als auch was die Traumata von Menschen immer nachhaltig. An diesem Beispiel lässt sich sehr gut sehen, dass mit Nachhaltigkeit Folgen gemeint sind, die in der unmittelbaren Gegenwart (Hier und Jetzt) verursacht werden und noch weit, d.h. über Generationen in die Zukunft reichen. In dieser Zukunft sind dann unter anderen Menschen davon betroffen, die an der Verursachung keinen Anteil hatten, weil sie zum Beispiel Kinder gewesen sind.
Ursprünge des Nachhaltigkeitsdiskurses: Ökofeminismus
Der Begriff Ökofeminismus wurde zu Beginn der 1970er Jahre im Kontext der neuen Frauenbewegung erfunden. Als seine Erfinderin gilt die französische Intellektuelle, Science Fiction-Autorin, Anarchistin, Philosophin Francoise d´ Eaubonne. Sowohl in ihrem SF-Roman „Les bergères de l´ apocalypse“ (d´Eaubonne 1978) als auch in ihrer frühen Streitschrift „ Le féminisme ou la mort“, Feminismus oder Tod (d´Eaubonne 1975 ) diskutiert und präsentiert sie ein Szenario einer nachhaltigen Gefährdung der Erde, verursacht durch die patriarchalischen Herrschaftsstrukturen in der Gesellschaft.
D´Eaubonne steht für eine feministische Radikalität der 1970er Jahre, zugleich ist sie aber auch eingebunden in die französischen intellektuellen Kontexte, in denen Dekonstruktion und postmoderne Ideen entwickelt wurden. D´Eaubonne kritisiert die Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern und die Herrschaft der Männer in den politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und familiären Sphären der Gesellschaft, sie analysiert vor zudem die heteronormative Machtstruktur der Gesellschaft, die schwule und lesbische Lebensweisen gewaltsam unterdrückt. Dieses Machtgeflecht, das sich durch die Gesellschaft zieht, findet sich in den Individuen und ihren Verhaltensweisen wider und ist auch ein Grund für die Ausbeutung und Vernichtung von Natur, also der ökologischen Lebensbedingungen.
Denn, so die Logik des poststrukturalistischen Ökofeminismus, eine Gesellschaftsstruktur, die die gewaltförmige Unterdrückung von Menschen zulässt und per Gesetz legitimiert, übt Gewalt gegen die Natur aus, und für Natur steht der Mensch ebenso wie die Umwelt. D´Eaubonne denkt also Natur-Mensch-Umwelt als eine Einheit und sie thematisiert, dass die Lösung nicht in der Machtübernahme durch die Frauen liegen würde, sondern in der Abschaffung von Herrschaftsverhältnissen überhaupt. In der Konsequenz bedeutet das, dass die Erde vor der ökologischen Zerstörung nur gerettet werden kann, wenn die Gesellschaft, die Menschen sich humanisieren und sich selbst als Natur respektieren und in humane, horizontale und partizipative Verhältnisse miteinander eintreten.
Der Begriff der Nachhaltigkeit spielt hier noch keine Rolle, das Denken ist jedoch auf eine Zukunft ausgerichtet, der eine Katastrophenprognose beigegeben wird, bei gleichzeitigem Angebot einer politischen Lösung im Hier und Jetzt. Viele Forderungen der Frauenbewegungen wurden tatsächlich sukzessive seit den beginnenden 1970er Jahren in vielen Ländern umgesetzt und haben zu neuen Wertesystemen in der Gesellschaft geführt (wie zum Beispiel die Entnormalisierung von Gewalt gegen Frauen und Kinder; die Anerkennung von sexueller und Gendervielfalt), nicht unbedingt trotz, sondern möglicherweise wegen der Radikalität der Frauenbewegung. Gleichstellung ist jedoch ebenso wie die Einhaltung der Milleniumsziele der UN fern davon tatsächlich realisiert zu sein, ein neuer Survey, zeigt, dass kein Land der Erde Gleichstellung bis 2030, wie von der UN intendiert, erreichen wird.
Der Nachhaltigkeitsdiskurs ist der Entstehung der sozialen Bewegungen in den 1970er/Jahren nachgeordnet, tatsächlich haben diese Bewegungen die heutigen Inhalte des Diskurses zutiefst in Theorie und Praxis hervorgebracht, geprägt, und die Akteur*innen dieser Bewegungen bestimmen ihn bis heute. Dieser Diskurs war auch von Anfang an, in allen Bewegungssträngen, Frauen-, Ökobewegung, Friedensbewegung u.a. begleitet von Rhetoriken der Katastrophe, der Apokalypse, des Untergangs. Diese hatten möglicherweise einen machtvollen Effekt auf die politische Durchsetzung der Anliegen. Auf die Vielfalt der Anliegen und der Aktivitäten dieser Bewegungen ist meines Erachtens die breite Aufstellung des zur Zeit hegemonialen Nachhaltigkeitsdiskurses zurückzuführen. Denn, ähnlich wie d´Eaubonne, geht dieser Ansatz davon aus, dass sämtliche gesellschaftlichen Strukturen einer Veränderung unterzogen werden müssen.
Nachhaltigkeitsdiskurse
Drei konkurrierende Diskurse von „Nachhaltigkeitsdenken“ werde ich im folgenden darstellen:
den Pro-, Anti- und Post-Nachhaltigkeitsdiskurs
Pro-Nachhaltigkeitdiskurse
Schauen wir uns zunächst auf den Pro-Nachhaltigkeitsansatz als nunmehr Top Down – Ansatz, vertreten durch machtvolle internationale und nationale Organisationen, Universitäten und Hochschulen eingeschlossen. Als Weg weisend hervorgehoben, wird häufig das Brundtlandpapier. Drei Grundprinzipien der Analyse und der Praxis werden hier festgelegt: die globale Perspektive, die Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungsaspekten und die Realisierung von Gerechtigkeit. Bei der Gerechtigkeit werden zwei Perspektiven unterschieden: „…die intergenerationelle Perspektive, verstanden als Verantwortung für künftige Generationen, und die intragenerationelle Perspektive im Sinne von Verantwortung für die heute lebenden Menschen, v. a. für die armen Staaten und als Ausgleich innerhalb der Staaten. Die Realisierung nachhaltiger Entwicklung enthält daher drei ethisch motivierte Grundforderungen: „Bewahrung der Umwelt, Herstellung sozialer Gerechtigkeit und Gewährleistung von politischer Partizipation“ (BELEG).
Wir finden hier eine auf Zukunft ausgerichtete Definition von Nachhaltigkeit, die interpretationsoffen ist und unterschiedlich ausgefüllt werden kann. Die Mehrdimensionalität erlaubt, dass Demographie, Ökonomie, Fragen sozialer Gerechtigkeit, Migration, Teilhabe unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, Bildung, Partizipation, Sicherheit, Naturwissenschaft und Technik ins Spiel kommen. In diesen Auslegungen finden sich nahezu alle Reflexe der sozialen Bewegungen der 1970er Jahre wider, nur nicht mehr in Protest- oder Grassrootbewegungsformen, sondern als nationalstaatlich und international aufgelegte Programme. Nachhaltigkeit ist als Projekt gedacht, dass sich offenbar nur unter zivilgesellschaftschaftlichen, demokratischen, partizipativen Strukturen realisieren lässt. Die Ideen von Nachhaltigkeit sind hier: Kontinuität, ethische Orientierung, die belohnt wird, wenn sie berücksichtigt wird, sowie die Beziehungsverhältnisse zwischen den Generationen, zwischen Menschen zu Tieren, zur Natur. Auf allen Ebenen nimmt Bildung, die so bezeichnete Bildung für nachhaltige Entwicklung, neben der Wissenschaft den zentralen Stellenwert ein.
Im Workbook UNESCO 2012 werden die Bildung für nachhaltige Entwicklung pädagogische Methoden bereit gestellt, die geradewegs aus den 1970er Jahren stammen, zu dieser Zeit in Deutschland aus amerikanischen Kontexten zum Teil importiert, oder rückimportiert wurden. Wenn man sich zum Beispiel den konstruktivistischen Methodenpool der Uni Köln ansieht, findet man dort das gesamte Repertoire, das in zahlreichen Papieren zur nachhaltigen Bildung aufgegriffen wird. Interessant ist hierbei, das die Bildungsmethoden bereits in den 1970er Jahren in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in sozialen Bewegungen umgesetzt wurden, in der autoritätsgebundenen Pädagogik der Schulen und Hochschulen in Deutschland waren diese Methoden nur minoritär vertreten. Nach fast 50 Jahren soll nun mit ihnen die Welt gerettet werden.
Anti-Nachhaltigkeitsdiskurs
Die Vertreterinnen der Antinachhaltigkeitsdiskurse, zum Beispiel repräsentiert durch das europäische Institut für Klima und Energie, lehnen den Begriff der Nachhaltigkeit faktisch ab. Vertreterinnen sind Skeptikerinnen, Kritikerinnen des zuvor dargestellten Nachhaltigkeitsdiskurses. Sie argumentieren mit einem Fokus auf Hier und Jetzt, also gerade nicht auf die Zukunft orientiert. Andere Ansätze gelten ihnen als Ideologie, also der Versuch eine, nur eine einzige Wahrheit zu zulassen und für richtig zu erklären. Wachstum, Konsum finden in der Gegenwart statt und haben so viel Nutzen für die Gesellschaft, dass sie nicht ohne Verluste durch andere Konzepte von Ökonomie und Konsum ersetzt werden können. Gesellschaftiche Bewegungen, wie die Kinder- und Jugendbewegungen oder Genderbewerungen in der Gesellschaft und Wissenschaft werden einer diskriminierenden und abwertenden Rhetorik unterzogen werden, kurz extrem ideologisch behandelt. In einem Anti-Nachhaltigkeitsdiskurs brauchen Kinder und Jugendliche auch keine besondere Rolle, weil sich die Generationengerechtigkeitsfrage oder andere Gerechtigkeitsfragen in dieser Logik nicht stellen. Die Herabsetzungsrhetorik erscheint bei einem Institut mit wissenschaftlichem Anspruch geradezu wie eine Widerlegung seiner selbst.
Post-Nachhaltigkeitsdiskurs
Der Post-Nachhaltigkeitsdiskurs (Post Sustainability, After Sustainability, Queering Sustainabiltity) ist im Selbstverständnis seiner Vertreterinnen ein dekonstruktivistischer Diskurs. Sie beziehen sich explizit auch auf feministische und queere Ansätze der Gender-, Diversity- und Postcolonial Studies. Morton (2018) oder Wallis-Wells (2019) interpretieren die aktuelle Situation als eine Art postraumatischer Belastungssstörung. In diesem Verständnis haben die Menschen sich selbst traumatisiert (durch Umweltverschmutzung, Vergiftung von Ressourcen, Artenzerstörung, sexistische, rassistische u.a.Herrschaftsstrukturen, ökonomische Ausbeutung etc.), so dass sie nun mit den Folgen zurecht kommen müssen (Morton 2018). Diese sind, kennzeichnend für ein Trauma nicht revidierbar, sondern bestenfalls reflektiert in der Gegenwart in Bewältigungsversuchen integrierbar. Fight, flight, freeze sind die einzig möglichen Reaktionen während einer traumatischen Situation, und genau diese werden auch später wieder in der PTBS hervorgerufen, übertragen würde das zum Beispiel heißen: die Aktivistinnen, die kämpfen, wie z.B. die Fridays for Future – Bewegung oder Extinction Rebellion; diejenigen, die nur wahrnehmen und nichts tun (können) oder verleugnen; diejenigen, die aussteigen oder fliehen. Morton thematisiert, dass es kein Außen in diesem Diskurs gibt, auch kein Außen eines Metadiskurses. Niemand kann aus der Distanz darauf schauen und aus der Metaperspektive Lösungen eröffnen, jede Metadebatte wird zur Debatte im Hier und Jetzt und jede Person ist Teil davon (Morton 2010). In diesem Sinne verhalten sich alle ökologisch und nachhaltig, sind alle Teil des Prozesses Natur. Die Imagination, das Natur rein, friedlich, sanft sei, wird auch im heutigen Ökologie- und Nachhaltigkeitsdiskursen wirksam sowie der Wunsch, gerade das zu schützen. Morton zeigt auf, dass Natur gefährlich, bakteriell, giftig, gewaltsam sein kann, und der Mensch als Natur ist das auch oder kann es sein. Die Nicht-Fähigkeit der Natur, inklusive der Menschen, intelligente Systeme auszubilden, die Zerstörung und Selbstzerstörung hinter sich lassen, bringt auch immer wieder Zerstörung hervor, so wie es seit Entstehung der Erde und der Menschheit passiert ist. Aus Zerstörung geht nicht zwangsläufig Zerstörung oder völlige Zerstörung hervor, sondern neue Variationen, neue Formen. Zerstörung ist wie Tod im Leben von Menschen unvermeidbar, sie wird geschehen, sie wird dem Einzelnen wie der Erde zustoßen (Morton 2018).Nachhaltigkeit kann deswegen nur als Utopie oder Fantasie existieren. Für Morton hat das Ende der Welt bereits statt gefunden, nämlich in der Erkenntnis, dass das ökologische System und der Mensch keine getrennten Systeme, sondern ineinander eingeschrieben sind. Aus dieser Perspektive ist der derzeit hegemoniale Nachhaltigkeitsdiskurs ein Kontrolldiskurs, ein Illusionsdiskurs, ein Herrschaftsdiskurs oder ein Diskurs des Sicherheitsdenkens, das letzte Refugium Paranoia und Todesängste zu vermeiden, der letzte Garant, die Zukunft und die Lebensbedingungen beinflussen zu können (Morton 2018). Am Beispiel „Plastik in der Welt“ expliziert Morton seinen Grundgedanken:
„Imagine all the plastic bags in existence at all : all of them, all that will ever exist, everywhere. This heap of plasticbags is a hyperobject: it´s an entity that is massively distributed in space and time, and in such a way that obviously transcends merely human acess modes and scales.“ (Morton 2018, 126).
Nachhaltigkeit in dieser Denkstruktur ist Bewältigung in die Unendlichkeitsdimension gedacht, konstantes Copying mit dem, was soeben in der Gegenwart geschieht und die Suche nach Handlungsoptionen, die akutelle Möglichkeiten im Moment auch übersteigen können. Post-Nachhaltigkeitstheoretiker*innen sprechen sich nicht gegen die derzeitigen Nachhaltigkeitsinitiativen aus, die sollen weitergehen, aber ihre Grundlage, und damit ist Bildungsarbeit zum Beispiel gemeint, sollte eine ganz andere werden:
„Making political and personal choices to reduce the human eco- footprint can be thought of not as a route back to Eden but as a form of practical self-defense in a chaotic environment—as learning to swim, not planting eternal gardens. What we should crave is not stasis—would we want it if we could get it?—but room to maneuver. We need options, not sustainability.“
Wenn der Nachhaltigkeitsdiskurs selbst auf politischer und wissenschaftlicher Ebene durch Pluralität und Diversität von Perspektiven geprägt sein könnte, würden hieraus vermutlich neue Dimensionen, neue Ideen entstehen, die aktuell durch hegemoniale Diskurse – sowohl Nachhaltigkeits- als auch Antinachhaltigkeitsdiskurse – nicht zum Tragen kommen. Feminist ecology und queer ecology spiegeln hier in einem Teildiskurs, was das bedeuten könnte. Geschlechterverhältnisse, die stereotypen Zuweisungen, was männlich und weiblich sein soll, die Setzung der Heterosexualität als einzig richtige und vermeintlich „natürliche“ Lebensform hat und führt immer noch zu Unterdrückung und Gewalt und Auslöschung gegenüber denjenigen, die die Vielfalt des Lebens repräsentieren. Leben ist nicht essenziell, natürlich, eindeutig, sondern komplex, divers. Die Einbeziehung dekonstruktivistischer Diskurse würde bedeuten, dies denken zu lernen. Für die Bildungsarbeit würde das heißen, die erfahrungsbasierten, monokulturell ausgelegten Ansätze aus den 1970er Jahren zu erweitern durch: kognitive Bildungskonzepte, wo nicht nur die Wissensaneignung, das erfahrungsbasierte Lernen oder das Lernen des Lernens integriert sind, sondern zudem die Reflexion der Denkstrukturen und ihres Zustandekommen selbst. Bildungsansätze, die über die 1970er Jahre Didaktik hinausweisen, liegen vor oder werden soeben entwickelt: Gender- , Queer- und Diversitypädagogik, Resonanzpädagogik, Compassionate education, Traumapädagogik, Neue Mediendidaktik, Neurodidaktik, Interaktionsdidaktik, Dialogdidaktik, Meta- bzw.Meta-Meta-Didaktiken, Pluralitätspädagogik, Partizipative Didaktik. Ein plurales Feld von neuen Ansätzen liegt vor, das alles kann Hier und Jetzt sogleich umgesetzt und diskutiert werden und die Perspektiven des Nachhaltigkeitsdiskurses erweitern.
Literaturverzeichnis
Barth, Matthias (2011): Den konstruktiven Umgang mit den Herausforderungen
unserer Zeit erlernen: Bildung für nachhaltige Entwicklung als
erziehungswissenschaftliche Aufgabe.SWS Rundschau, 3, 275-291
Feminismus oder Tod (d´Eaubonne 1975 ): Les bergères de l´ apocalypse“ (d´Eaubonne 1978)
Derrida, Jacques (2008): The Animal That Therefore I Am, hg.v. Marie-Louise Mallet. New York
Foster, John (2015) : After sustainability. Denial, Hope, Retrieval. New York
Haraway, Donna (2007): When Species Meet. Minneapolis, Minnesota P.
Heinrichs, Harald/Michelsen, Gerd (Hg:) (2014): Nachhaltigkeitswissenschaften. Berlin, Heidelberg
Lange, Hellmuth (Hg.) (2008): Nachhaltigkeit als radikaler Wandel. Wiesbaden
DeLoughrey, Elizabeth / Handley, George B. (Hg.) (2011). Postcolonial Ecologies. Oxford, New York
Michelsen Gerd/ Godemann Jasmin(Hg.) (2005): Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation. Grundlagen und Praxis. München
Mortimer-Sandylands, Catriona/Erickson, Bruce (2010): Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire. Bloomington Indiana
Morton, Timothy (2010: Guest Column: Queer Ecology. PMLA, 125(2), 273–282. http://www.jstor.org/stable/25704424
Morton, Timothy (2018): Being Ecological, New York
Neckel, Sigrid et al. (2018): Die Gesellschaft der Nachhaltigkeit. Umrisse eines Forschungsprogramms, Bielefeld
Stadler, Christian (2017): Nachhaltigkeit als psychologische Herausforderung. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, Suppl. 1, 16, 93–109