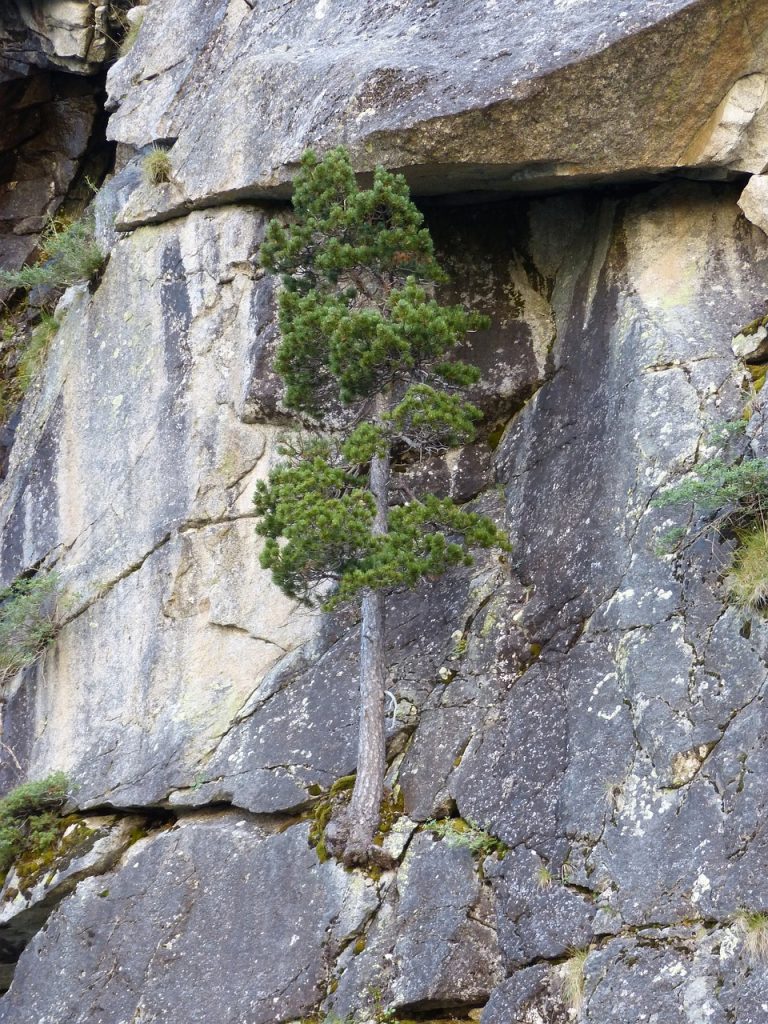
Bild von Marc Pascual auf Pixabay
Resilienz ist ein Begriff, der in den letzten Jahren eine massive Ausweitung erfahren hat. Der Begriff ist, nachdem er in der Militärforschung und der Pädagogik zunächst an Bedeutung gewonnen hatte, nun in fast allen gesellschaftlichen Bereichen zu finden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel. Hier gilt die Aufmerksamkeit der Ausbildung von community resilience, was nichts anderes bedeutet, als die Vorbereitung auf mögliche Katastrophen, sodass ein Überleben dennoch möglich wird. Im Bereich Sicherheit gilt nach Meinung der Regierung, ebenfalls die Bürgerinnen auf mögliche Katastrophen und Kriege vorzubereiten, so dass es nun ein deutsches Konzept zur Stärkung der Resilienz gibt. In diesen Resilienzkonzepten wird also immer vom schlimmsten Fall ausgegangen und Vorbereitungen darauf, gelten als Resilienzmaßnahmen. Da es dabei fast immer um Ressourcen geht, möchte ich den Begriff der Ressourcen hier zunächst erläutern, da er auch für die Pädagogik und Beratung relevant ist.
Ressourcen
Ressourcen sind Dinge, die wir wertschätzen, um unser Leben zu gestalten, und die wir zu diesem Zweck benötigen. Aus diesem Grund brauchen oder wollen wir diese Ressourcen und möchten sie sichern. Dazu gehören Dinge, die wir schätzen und die allgemein anerkannt sind, wie die materielle Umwelt, Unterkunft, Kommunikationsmittel (Handys, Computer usw.), Mobilität (Autos, Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln usw.) und Kleidung. Auch ein Aufenthaltstitel oder ein Reisepass sind Ressourcen. Ressourcen umfassen jedoch auch bestimmte Lebensbedingungen und Umstände, Zustände, die ich wertschätze, spezifische Bedingungen, die es mir ermöglichen, bestimmte Ziele zu erreichen, meinen Status, meine Sicherheit, Anerkennung und Zuneigung, die Menschen erhalten. Zu den Ressourcen gehören auch ein gesichertes Einkommen, Partnerschaft, Familie, Anerkennung innerhalb der Gemeinschaft und am Arbeitsplatz. Darüber hinaus werden persönliche Eigenschaften wie die Fähigkeit, Hilfe zu suchen, positives Selbstwertgefühl, Selbstregulation, Bewältigungsoptimismus und soziale Kompetenz werden ebenfalls als Ressourcen betrachtet. All diese Merkmale können den Zugang zu gewünschten Lebensbedingungen wie beruflichem Ansehen, Netzwerken, Freundschaften und Ruf erleichtern; Zugang zu bestimmten Mitteln und Bedingungen, um spezifische Ziele oder Lebensumstände zu erreichen; Zugang zu Geld; und Vertrauen von anderen; Zugang zu Informationen und Wissen. Damit bestimmte Dinge und Umstände zu Ressourcen werden, müssen spezifische Bedingungen erfüllt sein. Ressourcen sind kontextabhängig. Wenn der Strom ausfällt oder nicht verfügbar ist, hören elektrisch betriebene Geräte plötzlich auf, Ressourcen zu sein. Dann sind batteriebetriebene Geräte oder Kerzen erforderlich oder Solaranlagen, diese werden dann zu Ressourcen. Ressourcenorientierte Methoden sind ein gängiger Ansatz in der Beratung, Therapie, Sozialarbeit und Bildung. Es gibt viele Methoden, um die Ressourcen einer Person sichtbar zu machen, z. B. Lebenslinien, Genogramme, Fotoanalysen usw. Wenn Ressourcen identifiziert werden, dienen sie als Ausgangspunkt für weitere Verbesserungen im Leben, und Klientinnen haben oft das Gefühl, dass sie ihre Ziele erreichen können. Die Identifizierung der eigenen Ressourcen kann ein Gefühl von Stärke vermitteln.
Resilienz
Die am häufigsten verwendete Beschreibung im Bildungsbereich ist: Resilienz, die sich auf die Fähigkeit einer Person bezieht, autonom und selbstsicher durch das Leben zu navigieren, trotz herausfordernder und komplexer Stressbedingungen (wie dem Aufwachsen in Armut, dem Erleben von Gewalt oder Trauma):
(Grossmann/Grossmann 2009, 34).
„Die Lebensgeschichten resilienter Personen haben uns gelehrt, dass Kompetenz, Selbstwertgefühl und Mitgefühl selbst unter widrigen Umständen gedeihen können, vorausgesetzt, die betroffenen Kinder treffen auf Personen, die ihnen eine sichere Basis bieten, von der aus sie Vertrauen, Autonomie und Initiative entwickeln können. Es ist jedoch ebenso wichtig, den hohen Preis im Auge zu behalten, den solche Kinder möglicherweise zahlen müssen. Einige Schutzfaktoren, wie die Fähigkeit, sich durch Vermeidung oder Entfremdung von einer dysfunktionalen Familie zu distanzieren, können zu einer erfolgreichen Anpassung an die soziale Umgebung führen. In einem anderen Kontext und zu einem späteren Entwicklungsstadium können sie jedoch negative Folgen haben, wie das Vermeiden eigener Gefühle in engen Beziehungen.“
Ursprünge der Resilienzforschung und -bildung
Die Resilienzforschung ist mit der amerikanischen Militärforschung verbunden, die darauf abzielt, starke Soldat*innen auszubilden, die Risiko bereit sind und in der Lage zu töten, möglichst ohne selbst getötet oder verletzt zu werden oder nachhaltige Traumata zu erleiden. Studien über Kriegstraumatisierte haben gezeigt, dass einige Soldatinnen mit Trauma leichter umgehen als andere.
Die erste Längsschnittstudie zu Resilienz wurde jedoch von der amerikanischen Entwicklungspsychologin Emmy Werner durchgeführt. Die Kauai-Studie untersuchte 698 Kinder über einen Zeitraum von der Schwangerschaft bis zum Alter von 10 Jahren. Werner stellte fest, dass negative Einflüsse (wie pränatale oder Geburtskomplikationen, Armut, Vernachlässigung usw.) alle Kinder betreffen, aber etwa ein Drittel dieser Kinder nicht betroffen ist und daher als resilient gilt. (Werner 1977).
Definitionen von Resilienz in der Bildung
Aus der Kauai-Studie entstand eine allgemein akzeptierte Definition von Resilienz in der Bildung, die sie als psychologische Resilienz beschreibt, also die Fähigkeit, mit Situationen umzugehen, trotz hoher Stresslevel und signifikanter Risikofaktoren, und die „Fähigkeit, mit ‘nicht-normativen’ Entwicklungsproblemen oder einfach unerwarteten ‘Schwierigkeiten’ des Lebens, einschließlich Rückschlägen, umzugehen, ohne zusammenzubrechen, und möglicherweise sogar gestärkt daraus hervorzugehen.“ (Zander 2009).
Identifizierte Resilienzfaktoren in der aktuellen Forschung umfassen:
Angst und Furcht erkennen und akzeptieren
Einen moralischen Kompass haben
Bezug auf Glaubenssysteme
Soziale Unterstützung nutzen
Gute Vorbilder haben
Körperliche Gesundheit
Herausforderungen für das Denken suchen
Kognitive und emotionale Flexibilität
Bedeutung, Zweck und Entwicklung im eigenen Leben wahrnehmen
‘Realistischer’ Optimismus
Selbstmitgefühl
Weitere Faktoren, die Resilienz ermöglichen, sind stabile Bindungsmuster, Bildung, Bewusstsein für Selbstwirksamkeit und lebendige gute Erinnerungen. Der Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen (Wohlfahrtsstaat) und friedlichen Bedingungen ist ebenfalls zentral. Dennoch spielen individuelle Kontexte und Faktoren (Zufallsereignisse) ebenfalls eine Rolle. Faktoren, die zur Resilienz in von Armut betroffenen Familien beitragen, sind die Qualität der Bindung und der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die Beteiligung der Väter an der Kindererziehung und -pflege, intergenerationelles Wohnen und Netzwerke. Derzeit gibt es kein Messinstrument für Familienresilienz, aber zahlreiche Studien über Familien haben Faktoren abgeleitet, die zur Resilienz beitragen: Kohäsion, die durch Verständnis, Begreifen und Kommunikation geschaffen wird: Bindung, emotionale Verbundenheit bei gleichzeitiger Ermöglichung einer möglichen Autonomieentwicklung. Familienwertsysteme: Reflexion über schwierige Situationen und Vorstellung positiver Szenarien, Verbundenheit miteinander, die Fähigkeit, über aktuelle Probleme hinauszudenken und alternative Szenarien zu entwickeln. Religion und Glaubenssysteme Kommunikation Bewältigungsstrategien (zum Beispiel im Umgang mit Stress)
Resilienztraining mit jungen Menschen
Über einen begrenzten Zeitraum, z. B. drei Monate mit 90 Minuten pro Woche, konzentrieren sich solche Trainings auf die Identifizierung belastender und negativer Gedanken, das Erlernen von Unterbrechungsstrategien und die Etablierung alternativer Denkweisen. Sie umfassen auch das Training des Selbstbewusstseins, Verhandlungskompetenzen, Entscheidungsfähigkeiten und Problemlösungsfähigkeiten sowie das Erlernen von Entspannungstechniken. Effekte aus mehreren begleitenden Studien dieser Programme zeigen positive Ergebnisse hinsichtlich des Umgangs mit Depressionen, Auswirkungen auf die Schulbesuchsquote sowie Schulnoten. Diese Effekte halten jedoch nur ein Jahr an, bevor sie nachlassen. Daher könnte man in Frage stellen, ob man Resilienz wirklich speichern kann, falls schwierige Situationen auftreten.
Selbstmitgefühl als Resilienz
Die Gründerin der Selbstmitgefühlsforschung, Kristin Neff, unterscheidet zwischen Selbstwertgefühl und Selbstmitgefühl. Selbstwertgefühl ist mit einer Wertzuschreibung verbunden, die von anderen vermittelt wird; es ist an die Bewertung durch andere Menschen gebunden. Selbstwertgefühl wird oft mit gut oder schlecht verbunden und ist häufig an etwas Besonderes gebunden, nicht durchschnittlich im Wettbewerb und im Vergleich mit anderen zu sein. Somit wird das Selbstwertgefühl oft auf Kosten anderer etabliert. Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, führt dies oft zu negativen Folgen: Selbstverurteilung und Verurteilung anderer. Im Gegensatz dazu betrachtet Neff Selbstmitgefühl als Verständnis für sich selbst. Selbstmitgefühl macht unabhängig von anderen. Die freundliche und empathische Behandlung seiner selbst hat positive Auswirkungen auf die eigene Lebenssicht. Negative Situationen können neu interpretiert werden, wenn Verständnis für sich selbst vorhanden ist. Neff rät, sich selbst so zu behandeln, wie wir geliebte Menschen behandeln würden. Menschlichkeit beginnt beim Individuum und kann dann auf andere ausgeweitet werden. Achtsamkeit in Verbindung mit Selbstmitgefühl führt zu Bewusstsein und einer anderen Selbstwahrnehmung. Selbstreflexion anstelle von Selbstkritik (die das Selbstkonzept bedroht) führt zu einer konstruktiven Haltung. Freundlich mit sich selbst sowie mit anderen (z. B. Kindern) zu sprechen, lindert Stress und ruminative Gedanken. Forschungsergebnisse aus Neffs Studien: Effekte von Selbstmitgefühl:
Erhöhte Selbstwahrnehmung und Resilienz
Entspannterer Umgang mit Leistungsanforderungen und -ergebnissen
Mitgefühl für andere
Gesündere Lebensentscheidungen
Allgemeines Wohlbefinden und Lebensfreude
Motivation, Herausforderungen zu begegnen
Balance und Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen Viel weniger Selbstkritik
Selbstmitgefühl verändert die Wahrnehmung von Stress, und eine reduzierte Stresswahrnehmung verbessert das Gesundheitsverhalten. Selbstmitgefühl aktiviert Bereiche im Gehirn, die beruhigende Effekte haben. Wenn das System beruhigt ist, entstehen Gefühle von Sicherheit und Wohlbefinden, und es besteht keine Notwendigkeit für externe Mechanismen, um mit Angst und anderen negativen Gefühlen umzugehen (die immer Bewältigung erfordern, da sie als wahrgenommene Bedrohungen gelten). Zehn Minuten Selbstmitgefühlspraktiken, die über vier aufeinanderfolgende Tage aufgezeichnet wurden, reduzieren Stressgefühle, verringern Angst und verändern die Herzfrequenz (beruhigend). Selbstmitgefühl und verändertes Gesundheitsverhalten stehen im Zusammenhang mit verbesserten Selbstregulationsfähigkeiten und emotionaler Anpassung. (Homan/Sirous 2017
Es wird davon ausgegangen, dass die Stärkung der Resilienz von Kindern und Jugendlichen Schutz- und Sicherheitsfaktoren ausbildet. Dadurch können sie unabhängiger und autonomer ihr Leben gestalten. Ob Resilienz sich in existenziellen Bedrohungssituationen tatsächlich aktivieren lässt, bleibt für mich dabei eine offene Frage, denn der Fight-flight-freeze-Mechanismus wird durch Resilienz nicht außer Kraft gesetzt. Zudem vermute ich, dass Resilienz stärkende Tätigkeiten kontinuierlich praktiziert werden müssen, damit sie aktiv bleiben. Ebenfalls offen bleibt für mich derzeit die interessante Frage, ob Resilienztraining mit virtuellen Realitäten nachhaltige Resilienzeffekte erzeugen können.
Was denkt ihr dazu?
Literatur
Berking, M. (2010): Training emotionaler Kompetenzen, Berlin, Heidelberg, New York.
Crayton, P.: Compassion in Education. An Introduction to Creating Compassionate Cultures. Hg.: Foundation for Developing Compassion and Wisdom, London.
Gilbert, P. (2009): The Compassionate Mind. A New Approach to Life´s Challenges, London.
Gilbert, P. (2010): Compassion Focused Therapy, London und New York.
Grossmann,K.E./Grossmann: „Resilienz“ – skeptische Anmerkungen zu einem Begriff. In: Fooken, I./Zinnecker, J. (Hg.)(2009): Trauma und Resilienz. Chancen und Risiken lebensgeschichtlicher Bewältigung von belasteten Kindheiten. Weinheim und München.
Homan/Sirous (2017): Self-compassion and physical health: Exploring the roles of perceived stress and health-promoting behaviors . Health Psychology, Open July-December, 1–9.
Kabat-Zinn, J. (2013): Full Catastrophe Living. Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness, New York.
Neff, Kristin (2011): Self Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself. Yellow Kite.
Neff, K. (2012): Selbstmitgefühl.Wie wir uns mit unseren Schwächen versöhnen und uns selbst der beste Freund werden. München.
Reddemann, L. (2007): Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren
Reddemann, L. (2010): Psychodynamisch imaginative Traumatherapie für Kinder und Jugendliche. PITT – KID. Stuttgart.
Southwick,S. /Charney, D. (2012): Resilience. Cambridge: Cambridge University Press
Werner (1977): The Children of Kauai. A longitudinal study from the prenatal period to age ten. Hawai.
Walsh, F. (1998) Strengthening Family Resilience, The Guilford Press, New York.
Zander, M. (2008) Armes Kind – starkes Kind? Die Chance der Resilienz, Wiesbaden.
Zander, M. (2011): Handbuch Resilienzförderung. Wiesbaden.
Eigene.
